Nach der Entdeckung des kritische Bandbreiten-Phänomens
wurden mit großem Aufwand in einer Vielzahl von Versuchen wie dem
Band Widening-Experiment konkrete Werte für die kritischen Bandbreiten
ermittelt. Ein Ergebniss dieser Bemühungen war die 1961 von Eberhard
Zwicker
![]() publizierte Bark-Skala, deren Werte lange Zeit anerkannt und sehr einflussreich
waren und die daher an dieser Stelle erwähnt werden sollen. Mittlerweile
gelten diese Werte als nicht mehr ganz zutreffend. Stattdessen verwendet
man neuere Werte (meist die sogenannten
Cambridge-ERBs
publizierte Bark-Skala, deren Werte lange Zeit anerkannt und sehr einflussreich
waren und die daher an dieser Stelle erwähnt werden sollen. Mittlerweile
gelten diese Werte als nicht mehr ganz zutreffend. Stattdessen verwendet
man neuere Werte (meist die sogenannten
Cambridge-ERBs ![]() ).
).
Die grafische Darstellung der Bandbreiten-Werte der Bark-Skala und der Cambridge-ERBs veranschaulicht eine fundamentale Eigenschaft der kritischen Bandbreiten.
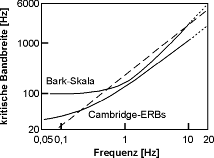
[Abb. 5.2] Abhängigkeit der kritischen Bandbreite von der Mittenfrequenz. Die gestrichelten Linie entspricht 1/3-Oktav-Bandpassfiltern. Oberhalb von 10 kHz liegen nur wenige experimentelle Ergebnisse zu kritischen Banbreiten vor, deshalb sind die Funktionen in diesem Bereich nur angedeutet.
Die kritischen Bandbreiten sind von der Frequenz abhängig und werden mit höherer Frequenz größer. Für die Bark-Skala kann man vereinfachend kann man sagen, dass die kritische Bandbreite bis zu einer Frequenz von ca. 500 Hz konstant 100 Hz beträgt. Darüber beträgt die kritische Bandbreite etwa 20% der Mittenfrequenz.
Die Cambridge-ERB-Werte beruhen auf Maskierungsexperimenten nach der Notched Noise - Methode. Ihr Zustandekommen wird ausführlich in Abschnitt 4: Das Filtermodell des auditiven Systems beschrieben. Beide Skalen ähneln grob Bandpassfiltern mit einer Bandbreite von 1/3 Oktave.
Diese Frequenzabhängigkeit der kritischen Bandbreite
äußert sich in einer Frequenzabhängigkeit der Mithörschwelle,
die am deutlichsten in Schwellenmessungen mit weißem Rauschen zu
Tage tritt. Obwohl weißes
Rauschen ![]() ein frequenzunabhängiges Leistungsspektrum
ein frequenzunabhängiges Leistungsspektrum
![]() besitzt, wird die Mithörschwelle für Sinustöne in weißem
Rauschen mit höherer Frequenz immer höher.
besitzt, wird die Mithörschwelle für Sinustöne in weißem
Rauschen mit höherer Frequenz immer höher.
Das liegt daran, dass die kritische Bandbreite mit der Frequenz größer wird. Bei höheren Frequenzen fällt daher mehr Energie des Rauschens in die Bandbreite, die effektiv zur Maskierung des Testtons beiträgt.